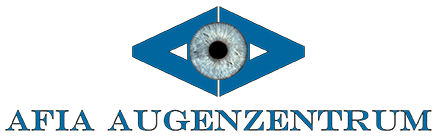Unsere Leistungen
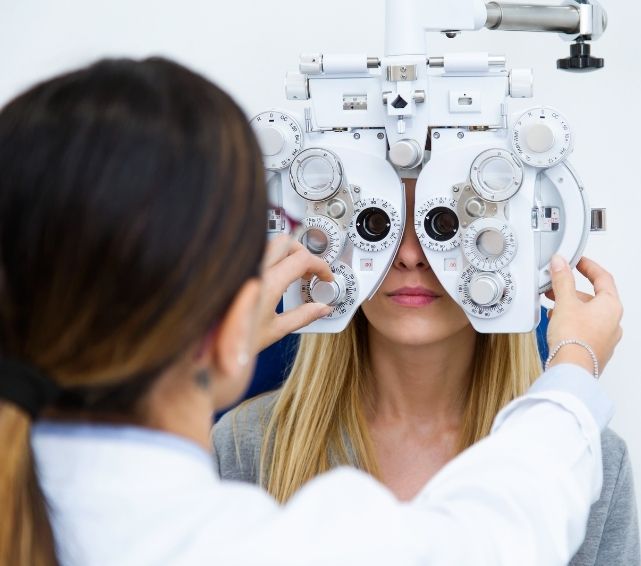
Vorsorge für Ihre Augen
Wie bei den meisten Fachärzten bildet auch bei uns die allgemeine Vorsorge den Grundpfeiler der augenärztlichen Tätigkeit. Das bedeutet eine regelmäßige Untersuchung des Vorderen und hinteren Augenabschnitts sowie Sehtests und Verlaufskontrollen bei Fehlsichtigkeit.
Der Visus (Sehschärfe)
Die Untersuchung der Sehschärfe (Visus) ist Teil der Standarduntersuchung die bei jeder augenärztlichen Kontrolle durchgeführt wird. Der Visus zeigt die Leistungsfähigkeit des Auges und ist definiert als Vermögen der Augen, zwei nebeneinanderliegende Punkte getrennt wahrzunehmen. Das höchste Auflösungsvermögen liegt dabei im Zentrum der Netzhaut (Retina) und nimmt nach aussen hin stetig ab.
Weitere Untersuchungen
Für eine gründliche Beurteilung der Augengesundheit führt der Augenarzt, zielgerichtet nach der Fragestellung, weitere spezifische Augen-Tests durch:
Betrachtung der verschiedenen Augenabschnitte
Der Augenarzt prüft die Augenlider, Tränenorgane, Bindehaut, Hornhaut, Linse und weitere Augenstrukturen auf Veränderungen. Zur Beurteilung der hinteren Augenabschnitte wie Netzhaut, Glaskörper und Sehnerv werden die Pupillen, falls nötig, mit Augentropfen weitgestellt und das Auge durch die Spaltlampe untersucht. Zusätzlich kann beispielsweise eine weitere Untersuchung der Netzhaut und ihrer Blutgefässe durch bildgebende Verfahren erfolgen.
Messung des Augeninnendruckes
Auch diese Untersuchung wird an der Spaltlampe durchgeführt. Nach dem die Hornhaut durch Augentropfen unempfindlich gemacht wurde, kann mit einem Messgerät der Augendruck bestimmt werden. Dies ist wichtig, da ein zu hoher Augendruck zur Entwicklung eines Grünen Stars (Glaukom) führen kann.
Prüfung der Augenmotilität
Die Untersuchung der Augenmuskeln ist auch Teil der Basisdiagnostik bei augenärztlichen Untersuchungen. Der Patient fixiert dazu eine vom Augenarzt gehaltene Lichtquelle und folgt deren Ortsänderungen ohne dabei den Kopf zu bewegen. Auf diese Weise kann ein Schielen oder andere Störungen der Augenmuskeln festgestellt werden.

LASIK-Augenoperationen (ab 2026)
Lebensverändernde LASIK-Augenoperation im AFIA Augenzentrum.
Gut sehen ohne Brille
Sie haben viele gute Gründe, sich für einen refraktiven Eingriff zu entscheiden. Sei es aus ästhetischen Überlegungen, einem besseren Komfort während Sport- und Freizeitaktivitäten oder weil der Umgang mit Kontaktlinsen aufwändig ist. Es kann auch sein, dass für Sie das Tragen von Kontaktlinsen aus medizinischen Gründen nicht mehr möglich ist.
Gerade bei hohen Glasstärken und relativ dicken Brillengläsern leidet Ihr Seheindruck, Ihr Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Ohne Brille ist die Orientierung selbst in den eigenen vier Wänden nicht mehr ohne weiteres möglich.
Wir möchten Sie bei der Entscheidung unterstützen und Sie auf Ihrem Weg in ein Leben ohne Brille begleiten.
Bin ich für das Augen-Lasern geeignet?
Es gibt verschiedene Verfahren, um Ihre Brille überflüssig zu machen. Für alle gilt, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sein sollten. Wir empfehlen jedoch, das 21. Lebensjahr abzuwarten.
Um sicherzugehen, dass sich Ihre Werte nach dem Lasern nicht mehr verändern, sollte Ihre Brillenstärke vor der OP zwei Jahre lang stabil geblieben sein. Das ist dann der Fall, wenn sich in diesem Zeitraum Ihre Glasstärke um nicht mehr als 0,50 Dioptrien verändert hat. Wir können dann davon ausgehen, dass Ihre Werte auch nach dem Eingriff stabil bleiben.
Weitere medizinische Voraussetzungen, wie beispielsweise Ihre Hornhautdicke und der Ausschluss von Hornhauterkrankungen, werden während der umfangreichen Voruntersuchung geklärt.
Wenn Sie eine hohe Brillenstärke haben oder Sie bereits eine Lese- oder Gleitsichtbrille benötigen, ist das Lasern oftmals nicht mehr die optimale Lösung. Gerne beraten wir Sie über mögliche Alternativen wie beispielsweise Linsenimplantate (ICL) und refraktiven Linsentausch.
Vereinbaren Sie Ihren Termin und wir Beraten Sie gerne über Ihre Möglichkeiten, unabhängig von Ihrer Brille zu werden.
Welche Laser-Verfahren gibt es für ein Sehen ohne Brille?
Allen Methoden gemeinsam ist, dass durch einen Materialabtrag die Wölbung und damit die Brechkraft Ihrer Hornhaut verändert wird. Es entsteht wieder ein scharfes Bild auf der Netzhaut: Sie sehen auch ohne Brille klar.
Wir bieten Ihnen alle gängigen Methoden der refraktiven Laserverfahren an: Femto-LASIK, ReLEx SMILE und PRK. Dadurch können wir Sie unvoreingenommen beraten.

Operation des Grauen Stars Katarakt
Eine Katarakt, auch Grauer Star genannt, ist die Trübung der körpereigenen Augenlinse. Wie beim Fotoapparat sorgt die Linse im Auge für ein scharfes Bild auf der Netzhaut. Die Trübung kann an beiden Augen unterschiedlich stark ausgeprägt sein oder auch einseitig auftreten.
Welche Beschwerden treten beim Grauen Star auf?
Durch die getrübte Linse kann das Auge nicht mehr Scharf sehen, ähnlich wie bei einer milchigen Fensterscheibe.
Die Folgen sind Anfangs oft eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit. Später wird das Bild immer unschärfer, bis schließlich sowohl Fern- als auch Nahsicht immer schlechter werden.
Was sind die Ursachen für den Grauen Star?
Die häufigste Ursache für den Grauen Star ist der natürliche Alterungsprozess. Dieser Beginnt bei der Augenlinse bereits mit der Geburt. Zunächst wird die Linse immer weniger elastisch, nach und nach färbt sie sich gelblich und wird mit der Zeit immer trüber. Eine Brille hilft in solchen Fällen oft nicht mehr.
Zusätzliche Faktoren wie Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen des Augeninneren, Medikamente oder Verletzungen können einen Grauen Star auslösen oder verstärken.
Wie wird der Graue Star behandelt?
Bisher gibt es keine Medikamente, mit denen wir den Grauen Star behandeln können. Sobald das Sehvermögen so schlecht wird, dass Sie im Alltag beeinträchtigt sind, beispielsweise bei der Arbeit, beim Ausüben von Hobbies oder auch im Straßenverkehr, kommt eine Operation in Frage.
Eine Katarakt-OP ist nie eine Notfall-OP. Den Zeitpunkt des Eingriffs entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt.
Was passiert bei der Operation des Grauen Stars?
Bei dem Eingriff wird die getrübte natürliche Linse mittels Ultraschall entfernt und durch ein klares Linsenimplantat (Intraokularlinse, IOL) ersetzt. Es handelt sich dabei um ein minimalinvasives Verfahren. Für diesen ambulanten Eingriff ist keine Vollnarkose erforderlich, das Auge wird örtlich betäubt.
Sollten Sie wegen medizinischer Gründe oder aufgrund großer Angst eine Vollnarkose benötigen, ist das nach Rücksprache mit unserem Team der Anästhesie ebenfalls möglich.
Welche Kunstlinsen stehen zur Auswahl?
Die Operation selbst führen wir bei allen Patienten in gleicher Weise durch. Die Kosten werden sowohl von den gesetzlichen Krankenkassen als auch von den privaten Versicherungen übernommen. Dazu gehört auch die Basislinse (Standard-IOL).
Neben den Basislinsen stehen weitere Linsen mit Zusatzfunktionen zur Auswahl:
- Asphärische Linsen mit verbessertem Kontrastsehen und verminderter Blendungsempfindlichkeit
- Linsen mit Blaulichtfilter zum Schutz der Netzhaut
- Torische Linsen, die eine Hornhautverkrümmung ausgleichen
- Multifokale Linsen mit einem ähnlichen Effekt wie dem einer Gleitsichtbrille
Die Kosten dieser Zusatzfunktionen werden von den Krankenkassen jedoch nicht übernommen.
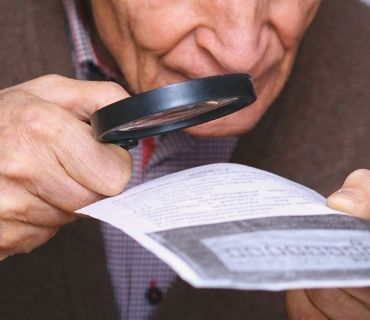
Die Behandlung von Makulaerkrankungen
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist die häufigste Ursache für eine erhebliche Sehminderung bis hin zur Erblindung in Deutschland und im Rest der westlichen Welt. Bei der AMD wird die Netzhaut im hinteren Bereich des Auges an der Makula angegriffen. Erfahren Sie alles zur AMD und wie wir Ihnen helfen können!
Was ist die Makula?
Im Zentrum der Netzhaut befindet sich die Makula lutea (Gelber Fleck). Dieser Bereich hat eine besonders hohe Dichte an den als Stäbchen bezeichneten Sinneszellen. Die Stelle des schärfsten Sehens ist die Sehgrube (Fovea centralis), die sich mitten in der Makula befindet.
Die Makula mit der Fovea sind der Teil der Netzhaut, mit dem wir unter anderem Dinge fixieren, Gesichter erkennen und lesen.
Was bedeutet Makuladegeneration?
Verschiedene Erkrankungen können zu Veränderungen in der Makula führen und dadurch die Sehkraft beeinträchtigen. Am bekanntesten ist die Altersabhängige Makuladegeneration (AMD). Es kommt es zu einer langsam fortschreitenden Verminderung der Sehfähigkeit.
Gesunde Ernährung, wenig Alkohol, nicht Rauchen und eine gute Versorgung mit Vitaminen und Lutein können helfen, den Befund zu stabilisieren. Leider ist die AMD aktuell nicht heilbar.
Seltener sind angeborene oder früh einsetzende Formen der Makuladegeneration (juvenile Makuladegeneration), die Makuladegeneration aufgrund hoher Kurzsichtigkeit (myopische Makuladegeneration) oder durch Entzündungen der Netzhaut. Auch durch manche Medikamente kann eine Veränderung der Makula ausgelöst werden (toxische Retinopathie).
Trockene und feuchte Makuladegeneration
Durch bestimmte Mechanismen können sich im Bereich trockenen Makuladegeneration neue Gefäße bilden, die dort eigentlich nicht hingehören. Diese kleinen Äderchen sind oft durchlässig für Flüssigkeit oder können bluten. Es entsteht ein Makulaödem. Wenn das geschieht, spricht man von einer feuchten Makuladegeneration.
Hier kann das Sehen innerhalb kurzer Zeit schlechter werden und eine bisher noch gute Sehkraft sehr stark vermindert werden.
Bei einer feuchten Makuladegeneration gibt es Behandlungsmethoden um das Ödem auszutrocknen. Auch hier kann leider keine Heilung erreicht werden, lediglich eine Umwandlung in die trockene und damit weniger aggressive Form der Makuladegeneration.
Wie wird ein Makulaödem diagnostiziert?
Manchmal können wir schon während der Untersuchung beim Blick auf die Netzhaut Veränderungen feststellen. Um die Diagnose zu sichern, benötigen wir aber bildgebende Untersuchungen.
Die Optische Cohärenztomographie (OCT) ist eine schnelle und schmerzfreie Untersuchung, mit der wir die innere Struktur und die feinen Schichten der Netzhaut exakt darstellen können. So können wir kleinste Veränderungen und minimale Flüssigkeitseinlagerungen erkennen. Nur wenn dann noch Zweifel an der Diagnose bestehen, sind weiterführende angiographische Untersuchungen mit intravenöser Farbstoffgabe nötig.
Wie wird ein Makulaödem behandelt?
Zur Behandlung des Makulaödems stehen uns verschiedene Medikamente zur Verfügung, die mittels einer extrem feinen Nadel direkt in das Augeninnere appliziert werden (IVOM). So kann das Medikament direkt an der Netzhaut wirken. Diese sogenannten VEGF-Inhibitoren sorgen dafür, dass sich krankhafte Gefäße verschließen und trocknen das Makulaödem aus. In manchen Fällen kann auch ein Medikamententräger mit Kortison im Auge platziert werden.
Da es sich um eine chronische Erkrankung handelt, sind in der Regel regelmäßige Kontrollen und eine langfristige Therapie mir mehrfachen Behandlungszyklen erforderlich.
Die Kosten für die Therapie und die Verlaufskontrollen werden von den Krankenkassen übernommen.

Allgemeine Vorsorge
In unserer Sprechstunde diagnostizieren und behandeln wir Ihre akuten und chronischen Beschwerden. Bitte schildern Sie schon am Telefon Ihr Problem so genau wie möglich, damit Sie in der Praxis nicht lange warten müssen.
Beachten Sie bitte, dass Sie nach einigen Untersuchungen nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.
Akute Augenerkrankungen
Akute Beschwerden treten oft plötzlich auf und können zum Teil sehr unangenehme Symptome verursachen.
Wir bemühen uns, Ihnen bei plötzlich auftretenden Problemen wie Bindehautentzündung, Lidentzündungen oder Allergien möglichst schnell einen Termin zu geben. Wir bitten Sie um Verständnis, dass es dadurch manchmal zu unvorhergesehenen Wartezeiten kommen kann.
Chronische Augenerkrankungen
Bei einigen chronischen Augenerkrankungen ist eine regelmäßige Verlaufskontrolle erforderlich.
Abhängig von Ihrer Erkrankung und dem Verlauf empfehlen wir Ihnen, einmal pro Jahr oder mehrmals jährlich zu uns zu kommen.
Notfälle
Fremdkörper oder Verletzungen gehören zu Notfällen, die schnell behandelt werden sollten.
Haben Sie akute Sehstörungen wie Blitze, Schatten, Flimmern oder Dunkelheit, sollten Sie bitte sofort anrufen oder – außerhalb unserer Sprechstunde – den fachärztlichen Notdienst beziehungsweise eine Augenklinik aufsuchen.
Das Gleiche gilt für Verätzungen: Mit Ausnahme von Verätzungen mit ungebranntem Kalk sollten Sie das Auge schon am Unfallort mit Wasser ausgiebig ausspülen (es geht auch eine andere neutrale Flüssigkeit wie Limonade oder Milch).
Gutachten
Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie einen Nachweis über das Sehvermögen benötigen, beispielsweise für einen Führerschein PKW oder LKW, einen Flug- oder Segelschein.
Die Kosten für Gutachten werden von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht übernommen. Wir beraten Sie gerne über die jeweils erforderlichen Untersuchungen und die entstehenden Kosten.

Grüner Star Glaukom
Ein Glaukom beeinflusst das gesamte Leben jedes Patienten. Schwierigkeiten im Alltag, Probleme im sozialen Umfeld und die ständige Furcht vor vollkommenen Sehverlust lösen einen starken Leidensdruck aus.
Was sind die Ursachen für ein Glaukom?
Beim Grünen Star handelt es sich um eine Krankheit mit verschiedenen Ursachen, die meist zusammenspielen. Oft besteht ein zu hoher Augeninnendruck, dem die Fasern des Sehnerven nicht auf Dauer standhalten können, weil die Durchblutung abnimmt (Primäres Offenwinkelglaukom, POWG).
Weitaus seltener kommt es trotz normalem Augeninnendruck zu einem Schaden am Sehnerven (Normaldruck-Glaukom). Auch hier ist die Sauerstoffversorgung des Sehnerven nicht ausreichend.
Eine weitere Variante des Grünen Stars ist das sogenannte Engwinkel-Glaukom. Hier ist im Gegensatz zu den ersten beiden Glaukomarten die Anatomie des Auges eine Ursache für den erhöhten Augeninnendruck. Durch das eng gebaute Auge kann das Kammerwasser den natürliche Abfluss im Kammerwinkel nur eingeschränkt passieren und es entsteht ein Grüner Star.
Zusätzlich spielen auch weitere Faktoren eine Rolle, wie Blutdruck und Kreislauf, Rauchen, Ernährung und bestimmte Stoffwechselprozesse.
Wie wird ein Glaukom diagnostiziert?
Oft entdecken wir ein Glaukom beim Glaukom-Vorsorge-Screening. Durch die Messung des Augeninnendrucks und die genaue Untersuchung des Sehnervenkopfes können wir typische Veränderungen feststellen und weitere Untersuchungen zur Diagnose eines Glaukoms veranlassen.
Behandlung mit Augentropfen
Meistens können wir den Grünen Star mit drucksenkenden Augentropfen behandeln. Je nachdem, wie Ausgeprägt die Augeninnendruckerhöhung ist, können auch mehrere Wirkstoffe kombiniert werden.
Behandlung des Glaukoms mit dem Laser (SLT)
Wenn die Senkung des Augeninnendruckes mit Augentropfen nicht ausreichend ist oder Sie Ihre Medikamente aus verschiedenen Gründen nicht anwenden können (beispielsweise bei Allergien oder Schwierigkeiten bei der Handhabung der Augentropfen) können wir den Augeninnendruck mittels eines schonenden Lasereingriffs (Selektive Lasertrabekuloplastik, SLT) senken.
Bei diesem Verfahren wird kein Gewebe zerstört und es entstehen auch keine Narben. Durch das Leserlicht können wir den Abbau und Abtransport von Pigmenten und Zellabfällen aus dem Abflusssystem anregen. Der Abfluss des Kammerwassers verbessert sich und der Augeninnendruck sinkt.
Die ambulante Behandlung ist in der Regel schmerzfrei und sehr nebenwirkungsarm.
Eine Operation als Therapie beim Glaukom
In schweren Fällen kann es sein, dass der Grüne Star mit einer Operation therapiert werden muss.
Manchmal reicht es aus, einen kleinen Stent im Kammerwinkel zu implantieren, um den Abfluss des Kammerwassers zu verbessern.
Es gibt auch Fälle, in denen eine sogenannte filtrierende Operation (Trabekulektomie) erforderlich ist. Diese Operation wird stationär in einem Krankenhaus von einem erfahrenen Operateur durchgeführt und bedeutet meist einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt.
Der akute Glaukomanfall – ein Notfall!
Im Gegensatz zu den bisher beschrieben Formen des Grünen Stars, die zunächst ohne merkliche Symptome einhergehen und langsam fortschreiten, handelt es sich beim Glaukomanfall um eine plötzlich auftretende und schmerzhafte Erkrankung.
Meist liegt ein eng gebautes Auge mit engem Kammerwinkel vor. Wenn die Regenbogenhaut das Abflussystems plötzlich verschließt, kommt es zu einem starken Anstieg des Augeninnendrucks.
Es handelt sich um einen das Auge bedrohenden akuten Notfall, der sofort behandelt werden muss. Bitte wenden Sie sich außerhalb der Sprechzeiten in diesem Fall an den fachärztlichen Notdienst unter der Nummer 116 117 (ohne Vorwahl) oder stellen Sie sich in der Notaufnahme einer Augenklinik vor.
Folgende Symptome sprechen für einen Glaukomanfall:
- Verschwommensehen
- Lichtkreise um punktförmige Lichtquellen wie Lampen oder Kerzen.
- manchmal Regenbogenfarben
- gerötetes und tränendes Auge
- starke Schmerzen am Auge
- Kopfschmerzen, oft einseitig
- Übelkeit bis hin zu Erbrechen

Sehschule (Pädiatrische Ophthalmologie)
Wir bieten allgemeine pädiatrische Augenheilkunde für Neugeborene und Kinder bis zu 18 Jahren.
Unsere Sehschule
In unserer Sehschul-Sprechstunde kümmern wir uns um die meist noch jungen Patienten mit Bewegungsstörungen der Augen (Schielen), Störungen des beidäugigen Sehens und Schwachsichtigkeit (Amblyopie).
Die Diagnostik und Behandlung leitet maßgeblich unsere Orthoptistin. Zusammen mit Ihnen und Ihrem Augenarzt plant sie die Therapie der vorliegenden Sehstörung und kontrolliert den Erfolg in regelmäßigen Abständen.
Insbesondere bei Kindern ist eine frühzeitige Behandlung von Schielstellungen und Schwachsichtigkeit wichtig, um eine optimale Entwicklung der Augen zu gewährleisten.
Was bedeutet Schielen?
Unter einer Schielstellung, dem sogenannten Strabismus, verstehen wir ein gestörtes Zusammenspiel der Augen. Das heißt, eines der Augen weicht von der Blickrichtung ab. Das kann offensichtlich sein oder auch versteckt. Die Folge ist ein eingeschränktes oder fehlendes räumliches Sehen. In ausgeprägten Fällen besteht die Gefahr einer Amblyopie (Schwachsichtigkeit).
Je nach Ausprägung der Schielstellung reicht die Therapie von einer passenden Brille bis hin zu einer Operation. Eine Operation empfehlen wir aber nur in ausgeprägten Fällen.
Welche Ursachen hat ein Schielen?
Oft handelt es sich um ein angeborenes Phänomen und ist häufig verbunden mit einer ausgeprägten Weitsichtigkeit (Hyperopie). Sobald wir eine passende Brille verordnen, tritt meistens eine Besserung ein.
Tritt das Schielen erst im Laufe des Lebens auf, müssen andere Ursachen abgeklärt werden, beispielsweise Muskelerkrankungen oder neurologische Probleme.
Wie wird eine Amblyopie behandelt?
Häufig ist die Ursache für eine Amblyopie (Schwachsichtigkeit) eine offensichtliche oder versteckte Schielstellung. Um Doppelbilder zu vermeiden, wird im Gehirn die Verarbeitung der Informationen des schwächeren Auges unterdrückt. Dadurch kommt es zu einer Schwachsichtigkeit obwohl das Auge selbst völlig gesund ist. Seltener ist ein hoher Unterschied in der Brillenstärke die Ursache und kann durch das rechtzeitige Tragen einer Brille vermieden werden.
Bei der sogenannten Okklusions-Therapie wird das »gute Auge« abgeklebt um die Entwicklung des Sehvermögens am betroffenen Auge zu fördern. In welchem Umfang die Okklusion durchgeführt wird, ist Abhängig vom Ausmaß der Amblyopie und dem Alter der Patientin oder des Patienten. Wichtig ist, dass wir rechtzeitig mit der Therapie beginnen, da die Entwicklung des Sehvermögens innerhalb der ersten Lebensjahre abgeschlossen ist und wir danach keine Besserung mehr erwarten können.